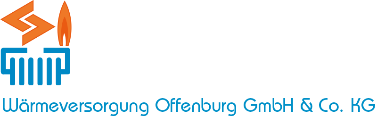Fragen zur Fernwärme allgemein und zum Fernwärmeausbau in Offenburg
Fernwärme ist eine moderne und effiziente Art der Gebäudebeheizung. Fernwärme deshalb, weil die Wärme über ein Rohrleitungssystem zu den Wärmekunden gelangt und keine eigene Heizanlage mehr benötigt wird. In zentralen Kraftwerken entsteht Wärme fürs Heizen und zur Trinkwassererwärmung, die aus unterschiedlichen Wärmequellen stammen kann.
In Offenburg wird die Fernwärme durch die Wärmeversorgung Offenburg GmbH & Co. KG (WVO) ausgebaut. Die WVO ist ein Unternehmen der Stadt Offenburg und des E-Werk Mittelbaden. Weitere Informationen, die Möglichkeit zur Interessensbekundung sowie die Kontaktdaten finden Sie unter www.waermeversorgung-offenburg.de
Die Stadt Offenburg geht den Pfad zur klimaneutralen Wärmeversorgung bis 2040. Mit dem aktuell stetigen Ausbau des Versorgungsnetzes eröffnen wir einer wachsenden Zahl an Bürger*innen die Möglichkeit zum Anschluss an eine zentrale Wärmeversorgung. Damit erfüllt die Stadt Offenburg das Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg zur kommunalen Wärmeplanung.
Fernwärme leistet einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz mit der Einbindung von erneuerbaren Energien wie PV, Wind- und Wasserkraft. Sie ist umweltfreundlich und mindert den CO₂-Ausstoß. Außerdem ist sie komfortabel und wartungsarm. Für Fernwärmekunden entfallen Heizölbestellungen und störende Gerüche. Es gibt keine Auslaufgefahr und Brennerprobleme. Liegt eine Wärmeleitung in der Nähe des Gebäudes? Dann ist der Umstieg sogar kurzfristig und problemlos möglich. Kessel und Brenner werden dann gegen eine Fernwärme-Übergabestation ausgetauscht. Das schafft Platz, weil die Übergabestation nicht größer als ein Warmwasserboiler ist. Attraktive Förderungen unterstützen außerdem den Umstieg auf ein neues Heizsystem.
Für den Gebäudeanschluss an unser Fernwärmenetz können Kunden eine Förderung für die Hausanschlussleitung, die Wärmeübergabestation sowie für Arbeiten beantragen, die ab unserer Fernwärmeübergabestation durch ein Heizungsbauunternehmen durchgeführt werden müssen. Diese Arbeiten beinhalten zum Beispiel die Demontage und Entsorgung der alten Heizung oder den hydraulischen Abgleich. Die Förderung kann im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) beantragt werden. Der Fördersatz liegt derzeit zwischen 30 Prozent und 70 Prozent. Bei Fragen zu Ihrem Förderanspruch wenden Sie sich bitte an Ihren Energieeffizienzexperten oder Ihr Heizungsbauunternehmen.
Der Ausbau des Wärmenetzes in Offenburg ist in vollem Gang. Insbesondere die Kernstadt soll zukünftig weitgehend mit Fernwärme versorgt werden.
Wo in Offenburg bereits heute Fernwärme verfügbar ist und in welchen Gebieten ein Ausbau in den kommenden Jahren geplant ist, zeigt diese Karte.
www.waermeversorgung-offenburg.de/waermenetz-offenburg
Die detaillierte Planung erfolgt durch die WVO und kann dort direkt erfragt werden: https://www.waermeversorgung-offenburg.de/kontakt
Nein, in Offenburg gibt es keinen Anschlusszwang.
2023 werden wir den Pelletkessel der Stadt Offenburg im Nord-West-Schulzentrum übernehmen und steigern damit unseren regenerativen Anteil im Fernwärmenetz. Mit der geplanten Abwärmenutzung integrieren wir 2023 weitere Abwärme in unser Netz, mit der wir rund 2.000 Haushalte versorgen können. Zudem planen wir die erste Hackschnitzel-Dampferzeugung in Offenburg mit Biomasse direkt aus der Region. Außerdem investieren wir ab 2024 in neue KWK-Anlagen, die mit regional verfügbaren alternativen Gasen betrieben werden können. Darunter zählen Klärgase aus der Vergärung von Biomasse sowie EE-Gase.
Aus Erneuerbaren Energien wird Wasserstoff erzeugt und zukünftig soll synthetisches Methan ein weiterer Baustein der Gasunabhängigkeit sein. Beim synthetisch erzeugten Methan wird aus dem Wasserstoff und der Spaltung von Kohlendioxid Methan erzeugt. Dieses ist wiederum speicherbar, kann dem BHKW zugeführt und verbrannt werden. Der Kreislauf zwischen Stromerzeugung aus EE-Anlagen (Solarstrom, Wind-und Wasserkraft) ist geschlossen. Nur gemeinsam können wir eine gute Zukunft schaffen.
Laut Umweltbundesamt ist die Gefahr der Legionellenbildung in Trinkwassersystemen zwischen 20-55°C am höchsten. Aus diesem Grund muss die Warmwassertemperatur auf 60°C eingestellt sein. Bei Einsatz einer Trinkwasserzirkulation darf die Temperatur nicht unter 55°C fallen. Die Fernwärme der WVO wird mit mindestens 75°C übergeben und stellt damit kein Risiko für die Gesundheit dar.
Bei einem zentralen Kraftwerksbetrieb kann die Energieumwandlung immer effizienter erfolgen als bei vielen dezentralen Anlagen. Vergleichbar ist das mit einem PKW, der für die ersten Minuten der Fahrt einen höheren Verbrauch hat und somit auch der Ausstoß der Schadstoffe deutlich erhöht ist. Gleiches gilt für die Fahrweise: Je gleichmäßiger, desto geringer ist der Verbrauch im Vergleich zu einer Fahrt mit vielen Beschleunigungs- und Abbremsvorgängen. Bei einem PKW mit herkömmlichem Verbrennungsmotor gehen über 60 Prozent des Kraftstoffs ungenutzt als Abwärme verloren. Das heißt, 60 Prozent des Tankinhalts werden nicht für den Fahrbetrieb genutzt.
Unsere KWK-Anlagen haben einen Wirkungsgrad von über 95 Prozent. Das heißt, lediglich 5 Prozent des eingesetzten Brennstoffs gehen ungenutzt verloren. Im Schnitt verlieren unsere Fernwärmenetze 5 Prozent an Wärme aufgrund der Leitungslänge. Diese geringen Wärmeverluste erzielen wir, indem wir stark isolierte Leitungen verwenden. Die großen Warmwasserspeicher unserer Kraftwerke ermöglichen einen Betrieb mit längeren Laufzeiten am optimalen Betriebspunkt. Laufzeit ist die Zeit, in der die KWK-Anlage im Jahr im Betrieb ist. Über die sogenannte Brennwertnutzung wird den Abgasen zusätzlich Energie entzogen. Insgesamt sinkt so der Ausstoß von CO2 und anderen Luftschadstoffen sowie Feinstaub.
Zudem ist geplant, den Einsatz erneuerbarer Wärmeenergie zu erweitern, um die Umweltverträglichkeit zu erhöhen. Dabei bietet sich der Einsatz von Biomasse genauso an wie die Verwendung von Wärmepumpen und Sonnenenergie. Auch ist die Nutzung von Abwärme der örtlichen Industriebetriebe kurzfristig umzusetzen.
Das Fernwärmenetz bietet den Vorteil, dass mehrere Erzeuger in ein Netz einspeisen. Das bedeutet, es stehen immer Redundanzen zur Verfügung, die Lastspitzen oder Ausfälle kompensieren können, ohne dass Wärmekunden Schwankungen bemerken. Zusätzliche Sicherheit gewährleisten in jedem Kraftwerk Spitzenlastkessel, die ein Vielfaches der Wärmeleistung bereitstellen, um in Extremsituationen schnell reagieren zu können.
In der Ortenau ist die Ortenauer Energieagentur die neutrale und unabhängige Anlaufstelle für alle Fragen zum Heizen, Sanieren und Energiesparen: www.ortenauer-energieagentur.de . Auf der Homepage der Ortenauer Energieagentur finden Sie ausführliche Informationen zum Heizungstausch, Förderprogrammen und der aktuellen Gesetzgebung.
Für den Ausbau der Fernwärme in Offenburg ist die Wärmeversorgung Offenburg zuständig und gibt Auskunft zur konkreten Ausbauplanung
Der Heizungswegweiser des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz bietet eine erste Einschätzung zur passenden Heizung für Ihr Zuhause. Auf der Seite des Ministeriums energiewechsel.de finden Sie außerdem weitere Informationen zum Gebäudeenergiegesetz und zu Förderprogrammen für den Heizungstausch.
Fragen rund um die Kommunale Wärmeplanung und das Erneuerbare-Wärme-Gesetz in Baden-Württemberg beantwortet das Umweltministerium hier.
Fragen zur Kommunalen Wärmeplanung
Ein kommunaler Wärmeplan bildet die Grundlage für eine klimaneutrale Wärmeversorgung. Die Wärmeplanung soll die Frage beantworten, welche Wärmeversorgungsoption in einem bestimmten Gebiet oder Teilgebiet besonders geeignet ist. Mit Hilfe dieses Fahrplans sollen die Kommunen die richtigen Entscheidungen treffen. Genauso soll er auch Bürgerinnen und Bürgern und anderen lokalen Akteuren bei ihren individuellen Investitionsentscheidungen unterstützen, welche Heiztechnologie für das jeweilige Gebäude am besten geeignet ist.
Die kommunale Wärmeplanung Offenburg (KWP) aus dem Jahr 2023 bildet die Grundlage für die Planung einer klimaneutralen Wärmeversorgung in Offenburg. Mit Hilfe dieses Fahrplans kann Offenburg die richtigen Entscheidungen für den Umbau der Wärmeinfrastruktur treffen. Genauso soll er auch allen anderen lokalen Akteure bei individuellen Investitionsentscheidungen unterstützen.
Die KWP Offenburg besteht aus einer Bestands- und Potenzialanalyse und definiert eine Wärmewendestrategie mit sechs prioritären Maßnahmen, die in den nächsten fünf Jahren umgesetzt werden sollen:
- Energetisches Quartierskonzept Südstadt
- Erweiterung des Nahwärmenetzes in Zell-Weierbach
- Erweiterung des Nahwärmenetzes in Griesheim
- Roadmap Umbau zur klimaneutralen Fernwärme
- Fernwärmeausbau bis 2027
- Kampagne zur energetischen Sanierung und Heizungsmodernisierung
Zudem enthält die KWP für jeden Stadt- und Ortsteil einen detaillierten Steckbrief mit Aussagen zum Gebäude- und Heizungsbestand, zu Potenzialen für erneuerbare Energien und Optionen für energetische Sanierung, Heizungsmodernisierung und die zukünftige Wärmeversorgung.
Bericht und Steckbriefe zur KWP in Offenburg können am Ende der Seite im Downloadbereich eingesehen werden.
Nein. Die bei der Erstellung der kommunalen Wärmeplanung ausgewiesenen Gebiete weisen lediglich einen informativen Charakter auf ohne rechtliche Folgen für Eigentümer*innen.
Nein. Der kommunale Wärmeplan ist eine informelle Planung ohne rechtliche Außenwirkung.
Allein das Vorlegen eines Wärmeplans durch die Stadt Offenburg löst nicht die Anwendung des Gebäudeenergiegesetzes aus. Hierzu bedarf es einer zusätzlichen Entscheidung der Gemeinde zur Ausweisung von Gebieten zum Neu- oder Ausbau von Wärmenetzen oder von Wasserstoffnetzausbaugebieten unter Berücksichtigung der Ergebnisse des kommunalen Wärmeplans. Dies ist in Offenburg derzeit nicht vorgesehen.
Fragen zur Heizung
Seit dem 1. Januar 2024 dürfe nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) in Neubauten innerhalb von Neubaugebieten Heizungsanlagen nur eingebaut oder aufgestellt werden, wenn sie mindestens 65 % der Wärme mit erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme erzeugen. Die Wärmeplanung spielt in diesen Fällen keine Rolle. Zur Erfüllung dieser Vorgabe können verschiedene Technologien genutzt werden: Fernwärme, Wärmepumpe, Biomasse oder viele andere, auch kombinierte Lösungen.
Mit der Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) wurde bei Bestandsgebäuden keine neue sofortige Pflicht geschaffen, bestehende Heizungen auszutauschen. Unabhängig von der aktuellen GEG-Novelle gilt bundesweit weiterhin die Regelung, dass Heizungen ausgetauscht werden müssen, die älter sind als 30 Jahre.
Zudem gilt in Baden-Württemberg bereits seit 2008 die Pflicht nach dem Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG), bei einem Heizungstausch in Bestandsgebäuden 15 Prozent erneuerbare Wärme zu verwenden oder Ersatzmaßnahmen zu ergreifen.
Erst ab dem 1. Juli 2028 muss nach GEG dann auch in Bestandsgebäuden jede neu eingebaute Heizung mit 65 % erneuerbarer Energie betrieben werden. Wichtig: Es geht nur um den Einbau neuer Heizungen. Vorhandene Heizungen können auch nach dem 1.7.2028 weiter betrieben bzw. repariert werden.
Da die CO2-Preise über die Zeit voraussichtlich teurer werden, lohnt es sich jedoch, bereits in den Übergangsphasen die Umstellung auf eine klimafreundliche Heizung mit Erneuerbaren Energien zu prüfen.
Ja, das ist grundsätzlich möglich. Allerdings müssen Sie entsprechend der Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) eine Energieberatung, beispielsweise durch Energieberater*innen oder einen Heizungsbetrieb in Anspruch nehmen, die unter anderem auf die wirtschaftlichen Risiken im Zusammenhang mit der ansteigenden CO2-Bepreisung hinweisen. Zudem müssen alle neu eingebauten Heizungen ab 2029 einen steigenden Anteil an Bioheizöl/Biogas/Wasserstoff einsetzen.
Nicht alle Heizungsanlagen sind dafür technisch geeignet. Fragen Sie dementsprechend bei Ihrem Heizungsbauer nach.
Seit 2008 ist es in Baden-Württemberg Pflicht nach dem Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG), bei einem Heizungstausch in Bestandsgebäuden 15 Prozent erneuerbare Wärme zu verwenden oder Ersatzmaßnahmen zu ergreifen. Ab dem 1. Januar 2045 dürfen keine fossilen Öl-/Gasheizungen mehr betrieben werden.
Auch wenn bei Ihrer Immobilie absehbar ist, dass voraussichtlich in den nächsten Jahren keine Möglichkeit zum Anschluss an ein Fernwärmenetz besteht, haben Sie viele verschiedene Möglichkeiten, um Ihre Wohnung/Ihr Haus zu heizen.
Die Regelungen im GEG sind technologieoffen gestaltet. Wer auf mindestens 65 Prozent Erneuerbare Energien umsteigt, kann auf mehrere pauschale Erfüllungsoptionen zurückgreifen. Durch die Nutzung einer dieser Optionen wird die Regelung ohne weitere rechnerische Nachweise erfüllt. Dazu gehören neben dem Anschluss an ein Wärmenetz zum Beispiel Wärmepumpen, Stromdirektheizungen, Solarthermie, Biomasse, erneuerbare Gase und Hybridlösungen.
Welche Lösung in Ihrem Fall die Beste ist, hängt von der individuellen Situation in Ihrer Immobilie ab. In einem Erstberatungsgespräch mit einem Energieberater kann dies näher untersucht werden.
Die Erfüllungsoptionen des EWärmeG sind teilweise andere als die des GEG: Beispielsweise sind ein Sanierungsfahrplan, baulicher Wärmeschutz, eine Photovoltaikanlage oder Kraft-Wärme-Kopplung Erfüllungsoptionen des EWärmeG, werden aber im GEG nicht zur (teilweisen) Erfüllung der 65 Prozent-Regel anerkannt. Wenn Sie sich für eine neue Heizung entscheiden, dann prüfen Sie bitte, ob diese nicht nur kurzfristig das EWärmeG, sondern auch langfristig das GEG erfüllt. Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater, z. B. der Ortenauer Energieagentur beraten.
Fragen zur Technik
Über einen Hausanschluss gelangt die Fernwärme zu der Übergabestation im Gebäude. Die Fernwärme-Übergabestation ist der Ersatz für die bisherige Heizungsanlage und wird anstelle des alten Heizungskessels in Ihrem Gebäude eingebaut. Wie bei herkömmlichen Wärmeerzeugern wird ihre Leistung in Kilowatt (kW) angegeben, dabei können sich die Temperaturen aber unterscheiden. Die Fernwärme-Übergabestation dient als Bindeglied und ist die Grenze zwischen dem Fernwärmenetz und Ihrem Hausnetz. Ausführbar ist sie als einzelne zentrale Station oder mit zusätzlichem Speicher und Wohnungsstation.
Bestehende Solaranlagen können die Wärme auch weiterhin in den Warmwasserspeicher abgeben. Das spart Kosten und schont effektiv die Umwelt. Sprechen Sie unsere Wärmeexperten, Stefan Böhler, Marcus Heizmann, Christian Linz, darauf an und wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen ein für Sie passendes Wärmekonzept.
Spitzenlastkraftwerke können alle Kraftwerke sein, die Wärme und Elektrizität in einer Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) erzeugen. Diese können Biomasse, Erdgas oder regenerative Gase sein. So wird der Energieinhalt eines Brennstoffs optimal mit hohen Wirkungsgraden genutzt.
Auch Großwärmepumpen, die den Strom aus EE-Anlagen beziehen, werden eingesetzt. Das E-Werk Mittelbaden baut die regenerative Energieerzeugung durch Windkraft-, Wasserkraft- und PV-Anlagen in der Region seit 2010 kontinuierlich aus.
Große Warmwasserspeicher am Kraftwerk sorgen dafür, dass die Anlage dauerhaft in Betrieb sein kann, was zu einer hohen Effizienz führt. Aktuell betreiben wir fünf KWK-Kraftwerke in Offenburg, das neuste ging im Frühjahr 2024 ans Netz und nutzt die Abwärme der Burda Druckerei in der Offenburger Nordoststadt. Zusammen liefern unsere Kraftwerke eine elektrische Gesamtleistung von 4.900 kW und versorgen bisher rund 10.000 Haushalte mit Strom und über 2.000 Haushalte mit Wärme.
Im Gegensatz zu einer klassischen Heizungsanlage in Wohngebäuden erzeugen KWK-Anlagen zusätzlich zur Wärme auch Strom. Dies geschieht in einem Verbrennungsmotor, der den Brennstoff in mechanische Energie umwandelt. Sie wird in einem Generator in elektrische Energie umgewandelt. Bei der Verbrennung entsteht Wärme, die an das Heizwasser abgegeben und in das Fernwärmenetz eingespeist wird. So gelangt schlussendlich das warme Wasser über das Fernwärmenetz zur Übergabestation in den Gebäuden.
Wasserstoff und Methan die über Elektrolyse und Power-to-Gas erzeugt werden, sind die Energieträger der Zukunft. Um wirklich nachhaltig zu sein, muss der für den Prozess verwendete Strom ausschließlich aus EE-Anlagen stammen. Gemeinsam mit der Wärmeversorgung Offenburg (WVO) dem E-Werk-Mittelbaden und den Bürgerinnen und Bürgern schaffen wir den Umstieg auf eine Wasserstofferzeugung aus Erneuerbaren Energien.
Neben den KWK-Anlagen wird ebenfalls industrielle Abwärme genutzt. Strom aus EE-Anlagen ist in Wärmepumpen eingesetzt. Zukünftig werden auch Biomasse-Anlagen einen Teil der Grundlast der Fernwärme abdecken. Die nachwachsenden Rohstoffe kommen ebenfalls aus der Region - ohne lange Lieferwege.
Der Klimawandel beschert uns immer längere und heißere Sommer. Der Bedarf an klimatisierten Räumen stieg in den zurückliegenden Jahren stark an. Neu ist die Kälteerzeugung durch den Einsatz von Fernwärme. Ankommende Wärme wird mittels eines Absorptionsprozesses in Nutzkälte umgewandelt und ermöglicht so die Raumklimatisierung.
Lithium-Bromid-(LiBr)-Kältemaschinen nutzen Wasser als Kältemittel. Unter Vakuumbedingungen wird Wasser verdampft. Der Wasserdampf wird in einer LiBr-Lösung absorbiert. Die mit Wasser gesättigte Salzlösung wird in den Austreiber gepumpt. Hier wird bei 80°C bis ca. 120°C durch Hitzeeinwirkung die Salzlösung ausgekocht. Wasserdampf und Salzlösung werden voneinander wieder getrennt. Kältemittel (Wasser) wird kondensiert und dem Verdampfer wieder zugeführt werden. Die Salzlösung wird dem Absorber wieder zugeführt. Der Kreislauf ist geschlossen.
Im Vergleich zu gewöhnlichen Kälteerzeugern ist der Strombedarf im Sorptionsprozess sehr gering. Es handelt sich um keine Kompressionskältemaschine, die elektrisch den Druck vergleichbar einer Wärmepumpe aufbaut, sondern wird mittels einer Salzlösung erzeugt. Chemische Bindungsenergie = absorbieren.
Unsere Wärmezentralen haben Heizkessel, die mit Heizöl betrieben werden können. Im Notfall werden die BHKWs ausgeschalten und die Versorgungssicherheit mit Wärme wird darüber sichergestellt.
Zur Abgasnachbehandlung kommt die sogenannte selektive katalytische Reduktion (SCR) zum Einsatz. Das Verfahren kommt auch bei Dieselfahrzeugen zum Einsatz und wird umgangssprachlich AdBlue genannt. Diese Behandlung der Abgase ermöglicht die Reduktion der schädlichen Stickoxide auf ein Minimum.
Fragen zur Abrechnung und Vertrag
Der Vertrag tritt mit Unterzeichnung in Kraft (Vertragsbeginn). Die Laufzeit des Vertrags beträgt zehn Jahre ab Beginn der vollständigen Betriebsbereitschaft der Übergabestation. Die vollständige Betriebsbereitschaft ist in einem gemeinsamen Protokoll dokumentiert, das der Kunde und die WVO unterzeichnen. Der Kunde verpflichtet sich, die gesamte Wärme für die Heiz- und/oder Brauchwasserwärmeversorgung von der WVO zu beziehen. Der Vertrag verlängert sich jeweils um weitere fünf Jahre, wenn er nicht spätestens 9 Monate vor Vertragsablauf (gem. § 32 Abs. 1 AVBFernwärmeV) durch einen eingeschriebenen Brief gekündigt wird.
Für die Versorgung mit Fernwärme ist ein Hausanschluss notwendig. Die Anschlusskosten sind individuell von den örtlichen Gegebenheiten abhängig. Die Gesamtkosten setzen sich zusammen aus einem
I. monatlichen Leistungspreis;
er beinhaltet die zur Verfügungsstellung der notwendigen Wärmeleistung inklusive der Wartungskosten und Instandhaltung der Wärmeübergabestation und der Fernwärmeleitungen
II. Messpreis;
er ist das Entgelt für die überlassene geeichte Messeinrichtung zur Erfassung Ihres Wärmeverbrauchs
III. Arbeitspreis;
der das Entgelt für die effektiv gelieferte Wärmemenge in Kilowattstunden (kWh) ist.
Anders, als bei einer herkömmlichen Heizungsanlage, bei der Sie selbst die Wartungsarbeiten beauftragen müssen, übernimmt die WVO die Wartung der Fernwärmestation. Wärmekunden brauchen sich um nichts zu kümmern. Unsere Serviceteams warten und prüfen die Anlage jährlich und können so den einwandfreien Betrieb der Wärmeübergabe gewährleisten. Das Beste dabei: Für die Wartung fallen keine weiteren Kosten an. Sie sind bereits im Leistungspreis enthalten.